Stellen wir uns vor, ich wäre ein unheimlich pedantischer Mensch – einer, der alles in seinem Leben organisiert. Meine Wohnung, meine Bücher, meine Arbeitsmaterialien … einfach alles. Nach einiger Zeit würde ich sicherlich auch anfangen, mein Gehirn zu ordnen. Schön verschachtelt, alles an seinem Platz.
Doch sobald ich damit beginne, mein Gehirn zu strukturieren, könnte es problematisch werden. Denn jeder neue Gedanke, der auftaucht, jede Frage, die mich beschäftigt, jede Aufgabe, die mir gestellt wird – alles müsste dieser strengen Ordnung unterworfen werden. Selbst ein einziger Gedanke würde geprüft, durchgecheckt und verortet: Wo gehört er hin? Welche anderen Gedanken stehen damit in Verbindung? Was muss noch bedacht werden, bevor er eingeordnet wird?
In diesem System hat alles seinen festen Platz – alles ist gleichberechtigt angeordnet. Es gibt kein Oben oder Unten, kein Wichtiger oder Unwichtiger, kein Interessant oder Unsinnig …
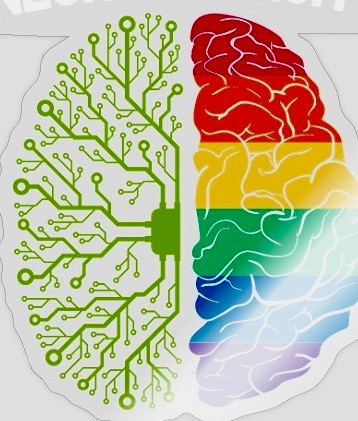
Wenn ich also einen Text erhalte, den ich lesen, bewerten oder kritisieren soll, kann ich kaum noch zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem unterscheiden. Alles erscheint mir bedeutsam, alles scheint erwähnenswert. Ob ein Gedanke falsch formuliert ist oder fünf Kommas fehlen – beides hat dieselbe Relevanz.
Wenn wir uns das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, dann wissen wir – oder können zumindest erahnen –, wie es Sherlock geht. Er muss sich ständig mit solchen Dingen auseinandersetzen.
Sherlock registriert alles in seinem unerbittlichen System: jedes Staubkorn, jedes Zucken eines Augenlids, jede Unstimmigkeit im Stoffmuster eines Mantels . Doch was andere bewundern mögen, ist in Wahrheit ein subtiler Fluch. Sein Geist funktioniert wie eine Maschine: präzise, unbestechlich, aber auch gnadenlos. Während neurotypische Menschen instinktiv filtern – „Das ist wichtig … das ignoriere ich“ –, muss Sherlock bewusst entscheiden, was er ausschließt. Und diese Entscheidung ist für ihn erschöpfender als das Beobachten selbst.
Der Preis der Klarheit: Jede Unterhaltung wird zur Analyse, jeder Mensch zum Puzzle. Selbst Watsons treue Freundschaft muss Sherlock erst entschlüsseln, bevor er sie einfach genießen kann.
Die Angst vor Leere: Wenn kein Fall da ist, bleibt nur das Rauschen der Details. Ohne ein Problem, das er zerlegen kann, wird sein eigener Geist zum Feind.
Das Misstrauen gegen Intuition: Sherlock verachtet, was er „Zufall“ nennt. Doch manchmal, ganz selten, beneidet er die Leichtigkeit, mit der andere Menschen ahnen, statt zu berechnen.
„Das Gehirn ist ein leerer Dachboden“, sagt der literarische Sherlock Holmes zu Watson. Aber unser Sherlock verschweigt – wie sein literarisches Alter Ego -, dass er selbst darin gefangen ist – zwischen akribisch sortierten Fakten und der unerfüllten Sehnsucht, einfach mal etwas nicht zu denken.
