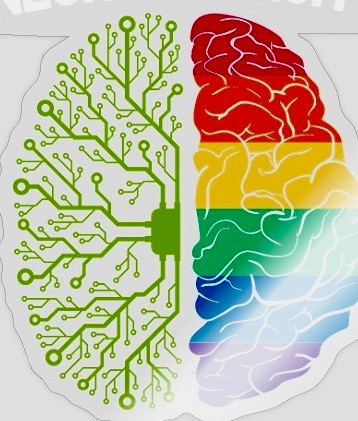Sherlock versuchte oft, sich anderen zu öffnen, doch meist stieß er auf Ablehnung. Seine Erzählungen weckten Argwohn und wurden nicht selten als Lügen abgetan. Niemand, so schien es, wollte länger in seiner Nähe bleiben, sobald klar wurde, dass er anders war. Nicht besser, nicht schlechter – einfach nur: anders. Nicht normal, sondern alternativ-normal.
Doch er sucht weder Bewunderung noch Verständnis. Er will nur einen Ort, an dem er sein darf, wie er ist. Wenn er jemanden trifft, der sich für Physik interessiert, stellte sich heraus, dass dieser den Rest des Tages vor World of Warcraft verbrachte. Wenn er jemanden kennenlernt, der sich mit Philosophie auskennt, betrank sich dieser am Wochenende bis zur Besinnungslosigkeit.
Sherlock aber kann das nicht. Will es nicht. Er trinkt nicht. Für ihn ist das Denken kein Spiel, keine Maske, kein Zeitvertreib. Es ist das, was ihn zusammenhält. Seine Intelligenz, seine geistige Schärfe – das sind die wenigen Dinge, die er an sich akzeptieren kann. Nicht viel vielleicht. Aber genug, um nicht unterzugehen.
Zugegeben, es ist nicht einfach, unter Gleichaltrigen man selbst zu sein – besonders unter denen, deren Gehirne anders verdrahtet sind, die sich für andere Dinge interessieren, die einfach kein Interesse daran haben, jemanden wie ihn zu verstehen. Doch vielleicht gelingt es Sherlock hin und wieder, über Hindernisse zu springen, ohne zu wissen, was ihn auf der anderen Seite erwartet. Vielleicht wagt er sich einfach mal in fremde Umgebungen – und findet dort, wonach er sucht…
Er hat die Muster erkannt: anfängliche Neugier, dann das unvermeidliche Stirnrunzeln, wenn er zu genau hinsieht, zu direkt fragt. „Du denkst zu viel nach“, heißt es dann. Als wäre Denken eine Krankheit, die man heilen kann.
Doch er kann nicht lügen – nicht einmal, um dazuzugehören.
Also akzeptiert er die Konsequenzen. Die Einsamkeit ist scharfkantig, aber ehrlich. Und manchmal fragt er sich, ob Ehrlichkeit genug sein kann.
Sherlock weiß, dass sein Gehirn anders funktioniert. Nicht weil es ihm jemand gesagt hätte – Diagnosen waren Luxus für Kinder, die laut genug schrien –, sondern weil er die Beweise sieht:
- Die Zeit, als er begann, sich mit Quantenphysik zu beschäftigen, während die Klasse über einfache Addition stolperte. Die Lehrer waren nicht erfreut („Woher weißt du das?“), nicht bewundernd, sondern misstrauisch.
- Die endlosen Elternabende, bei denen „soziale Anpassung“ zum Mantra wurde. Seine Mutter flüsterte danach immer: „Versuchs doch mal normal.“ Das Wort normal brannte sich in ihn ein wie ein Brandmal.
- Der Versuch, ihm Ritalin andrehen zu wollen. „Damit du dich besser konzentrieren kannst.“ Dabei konnte er sich blendend konzentrieren – nur nicht auf Dinge, die ihn nicht interessierten.
Doch das Schlimmste ist das Gefühl, falsch verdrahtet zu sein. Nicht kaputt, nein. Sondern wie ein Radio, das auf einer Frequenz spielt, die niemand sonst hört. Manchmal, wenn er versucht, sich anzupassen, gleitet er in ein „Script“ – lächelt zur richtigen Zeit, nickt im Takt der Konversation. Doch hinter seiner Stirn rattert es weiter: Warum lacht man jetzt? Was ist der soziale Nutzen von Smalltalk? – Die Welt verlangt Masken.
Also zog er sich zurück. Wenn er sich in Quantenphysik oder die Philosophie des Bewusstseins vergrub, hörte die Welt auf, wehzutun.
Man brachte ihn zu einem Psychotherapeuten.
Die Praxis war anders als erwartet. Keine Pastellfarben, keine falsch lächelnden Poster mit „Du schaffst das!“. Stattdessen:gemütlich, ein blauer Plüschelefant und ein Schachbrett auf dem Sideboard.
Watson – diesen Namen bekam er im Laufe der Zeit – schien auch anders, nicht wie befürchtet, und begann mit ihm Schach zu spielen. Die umgebende Stille war angenehm, nicht erzwungen.
Das alles war kein Script…
„Deine Mutter sagt, du hast Probleme mit sozialer Interaktion“, begann Watson. „Aber die Frage ist doch: Wer hat hier eigentlich ein Problem? Du – oder die Leute, die nicht verstehen, wie du funktionierst?“
„Sie wollen, dass ich sage, dass die Gesellschaft das Problem ist?“
„Ich will gar nichts.“ Watson zog eine Stirnseite hoch. „Außer vielleicht, dass du aufhörst, Energie in Masken zu stecken, die dir ohnehin nicht passen.“
„So läuft das nicht. Die Welt ändert sich nicht, nur weil ich…“ Seine Hände zitterten.
„Nein.“ Watson nahm die Brille ab. „Aber du musst dich nicht ändern, um in ihr zu leben. Nur lernen, wo die Ausgänge sind.“